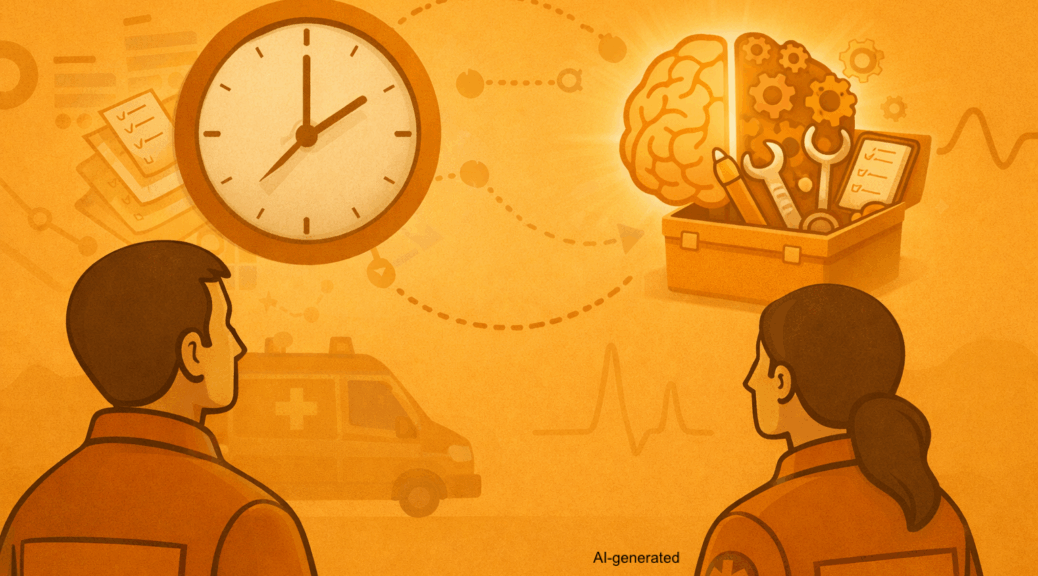
Fortbildung im Rettungsdienst: Was sich ändern muss
Wir messen Fortbildung in Stunden und tun so, als wäre das dasselbe wie Lernen
Im deutschen Rettungsdienst ist Fortbildung vielerorts vor allem eins: eine nachzuweisende Jahresstundenzahl. Je nach Bundesland sind das z. B. 30 Stunden/Jahr (u. a. Baden-Württemberg , Nordrhein-Westfalen), in Hessen mindestens 38 Stunden (inkl. Hygiene- und Pädiatrieanteil) und in Schleswig-Holstein im Durchschnitt 40 Stunden, mindestens 30 Stunden (Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), 1992; Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG), 2024; Verordnung zur Durchführung des hessischen Rettungsdienstgesetzes (RettDGV), 2011; Land Schleswig-Holstein, 2017).
Das ist zunächst nachvollziehbar, denn Stunden lassen sich leicht prüfen, verwalten und abrechnen. Doch genau hier beginnt das Problem. „30 Stunden Fortbildung“ ist eine Aktivitätskennzahl, die keine Aussagen über Qualitäts- oder Kompetenzgewinn erlaubt. Sie sagt nichts darüber aus, ob Inhalte für die Teilnehmenden neu waren, ob sie nachhaltig erarbeitet wurden, ob man dazu gezwungen war, eigene Unsicherheiten zu erkennen, oder ob sich das Handeln an der Patient:in dadurch verändert.
Diese Logik erzeugt eine Kultur, in der Fortbildung häufig als formale Pflicht erlebt wird und nicht als gezielte berufliche Weiterentwicklung. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das ein struktureller Kategorienfehler: Anwesenheit wird mit Wirksamkeit verwechselt.
Hochwertige Versorgung sichern
Fortbildung ist kein Selbstzweck. In hochdynamischen, risikobehafteten Arbeitsfeldern wie dem Rettungsdienst ist sie Teil der Systemantwort auf eine simple Tatsache: Wissen ändert sich, Anforderungen ändern sich und Handlungsfehler haben Konsequenzen. Im Diskurs der Patient:innensicherheit wird die Notwendigkeit systemischer Rahmenbedingungen für sichere Versorgung immer wieder betont, einschließlich der Unterstützung von Kompetenz und kontinuierlicher Entwicklung (World Health Organization, 2020).
Wenn Fortbildung diesem Anspruch gerecht werden soll, braucht sie (mindestens) drei Dinge:
- Bedarfsbezug: Sie muss an reale Kompetenz- und Performance-Lücken anschließen.
- Lerndesign: Sie muss Lernen ermöglichen, das über „Informationsaufnahme“ hinausgeht (z. B. Üben, Feedback, Reflexion, Transfer).
- Nachweis der Wirkung: Sie muss plausibel machen, dass sie die Praxis beeinflusst.
Gerade Punkt 2 ist entscheidend, weil die Forschung zu klassischen Fortbildungsformaten ernüchternd ist. Das Cochrane-Review zu „Educational meetings“ kommt zu dem Schluss, dass Fortbildungsmeetings als Hauptintervention professionelle Praxis wahrscheinlich nur leicht verbessert und Patient:innen-Outcomes kaum beeinflusst (Forsetlund et al., 2021). Das heißt nicht „Fortbildung bringt nichts“. Es heißt, Fortbildung bringt nicht automatisch etwas, schon gar nicht, wenn sie das Ziel verfolgt, eine Stundenpflicht zu erfüllen.
Der Stundenfokus setzt falsche Anreize
Sobald ein System eine Kennzahl zur Hauptwährung macht, optimiert es auf diese Kennzahl. Im Fortbildungskontext bedeutet das: Planung, Bewertung und Auswahl richten sich darauf aus, Stunden zu generieren und nachzuweisen.
Das erzeugt typische Nebenwirkungen:
- Minimal-Compliance: Man sucht Formate, die „anerkannt“ sind, nicht unbedingt solche, die die eigene Performance verbessern.
- Inhaltsinflation: Lieber breit, lieber viel, lieber „für alle etwas“ – denn dann rechtfertigt sich der Zeitaufwand.
- Reflexionsarmut: Reflexion ist schwer nachzuweisen, kostet kognitiv, ist unbequem und wird nicht belohnt, wenn am Ende nur die Zeit zählt.
Hinzu kommt die föderale Realität. Rahmenanforderungen unterscheiden sich.
Das Gießkannenprinzip ignoriert Unterschiede
Einheitsfortbildung im großen Stil folgt oft dem Gießkannenprinzip: ein Thema, ein Format, eine Zielgruppe „Rettungsdienstbereich“. Dieses Konzept ist zum Scheitern verurteilt, wenn andere Ziele als das „Erfüllen von Stundenvorgaben“ angepeilt werden. Zum einen unterscheiden sich die Rollen der Teilnehmenden teilweise erheblich. NotSan, RettSan, Praxisanleiter:innen, Leitstellenmitarbeiter:innen, Funktionsträger:innen haben ggf. unterschiedliche Kompetenzen und Fortbildungsbedarfe Aber auch innerhalb einer Rolle variieren Performance und Entwicklungsbedarf massiv. Berufserfahrung, Standort, Einsatzprofil, Teamkultur, persönliches Engagement, individuelle Vorerfahrung und Werte. Es gibt viele Gründe, warum sich die Fortbildungsbedarfe auch innerhalb eher homogener Gruppen (z.B. „nur NotSan“) unterscheiden können. „Eine Fortbildung für alle“ überfordert die einen und unterfordert die anderen.
„Mach doch selbst reflektierte Fortbildung“ funktioniert nicht – weil Selbstdiagnose begrenzt zuverlässig ist
„Dann sollen die Leute halt selbst erkennen, wo sie Defizite haben.“ Das klingt professionell, ist aber empirisch riskant. Das Systematic Review von Davis et al. (2006) zeigt, dass Ärzt:innen insgesamt eine begrenzte Fähigkeit zur akkuraten Selbstbeurteilung haben; besonders problematisch ist, dass gerade die am wenigsten Kompetenten ihre Leistung oft falsch einschätzen. Übertragen auf den Rettungsdienst heißt das nicht, dass Rettungsfachpersonal „nicht reflektieren kann“, sondern ein System, das Fortbildung primär auf Selbstdiagnose und Stundenpflicht stützt, öffnet Tür und Tor für bewusste oder unbewusste Fehlsteuerung. Einige würden hier bestimmt ebenso den Weg des geringsten Widerstands gehen.
Das Gießkannenprinzip verstärkt diesen Effekt sogar. Wer jährlich „Pflichtfortbildung“ absolviert, bekommt leicht das Gefühl: Ich habe ja getan, was verlangt wird. Die Teilnahmebescheinigung wirkt dann als psychologischer Ersatz für Kompetenz, ohne dass echte Performance-Lücken sichtbar werden. Und genau das hemmt Selbstreflexion. Nicht weil Menschen nicht wollen, sondern weil das System die falschen Signale sendet und Selbstreflexion nicht belohnt wird.
Seminarwissen ohne Transferdesign bleibt oft erfolglos
Selbst wenn Inhalte hochwertig sind, bleibt eine harte Wahrheit: Lernen muss in Verhaltensveränderung münden, sonst ist es Fortbildung ohne Effekt. Die Transferforschung zeigt seit Jahren, dass Transfer von Trainingsinhalten stark von Faktoren jenseits des Seminarraums abhängt: Arbeitsumgebung, Unterstützung, Gelegenheit zur Anwendung, Feedback, Motivation (Blume et al., 2010; Grossman & Salas, 2011).
Das erklärt eine typische Rettungsdienstrealität. Man besucht Fortbildungen, nickt sich durch Leitlinienupdates und arbeitet am Tag wieder so, wie man immer gearbeitet hat. Nicht aus Ignoranz, sondern weil Transfer nicht „passiert“, sondern gebaut werden muss.
Das ist der Kern meiner Kritik: Ein Fortbildungssystem, das überwiegend auf das Absitzen von Zeit und veralteten Lehr-Lernformaten setzt, wird am Schluss keine Veränderung in der patient:innenversorgenden Praxis generieren. Aber darum sollte es gehen.
Informales Lernen ist oft wirksamer – wird aber systematisch entwertet
Im Rettungsdienst passiert sehr viel Lernen außerhalb von Seminarräumen, beispielsweise Fachartikel lesen, Leitlinien diskutieren, Fallreflexion im Team, Hospitationen, Konferenzen, Qualitätszirkel, Debriefings nach kritischen Einsätzen. Aus Sicht der Bildungsforschung ist das nicht „nice to have“, sondern zentral: Informelles Lernen am Arbeitsplatz ist ein Hauptmotor beruflicher Entwicklung (Eraut, 2004).
Das Problem im aktuellen Vorgehen ist weniger, dass informales Lernen „nicht existiert“, sondern dass es häufig nicht als Fortbildung gilt. Damit entstehen erneut Fehlanreize:
- Man besucht lieber ein anerkanntes Seminar, statt eine fachlich dichte Fallreflexion zu machen oder einen Fachartikel zu lesen.
- Man optimiert auf Nachweisbarkeit, nicht auf Lernertrag.
- Lernen wird externalisiert („der Träger/Arbeitgeber muss mir Fortbildung geben“) statt professionalisiert („ich steuere meine eigene Entwicklung“).
Aus evidenzbasierter Perspektive ist das paradox. Das System entwertet genau die Lernform, die im Alltag am nächsten an realer Handlung liegt und privilegiert formale Formate, deren durchschnittliche Wirksamkeit begrenzt ist (Eraut, 2004; Forsetlund et al., 2021).
Wie es vielleicht besser gelingt, ein Beispiel aus dem UK
Ein hilfreicher Kontrast ist das Modell für Continuing Professional Development (CPD) der Health and Care Professions Council (HCPC) im Vereinigten Königreich, das auch Paramedics reguliert. Dort ist CPD nicht als „Stundenzahl“ im Zentrum beschrieben, sondern, wie die Bezeichnung schon verrät, als kontinuierliche berufliche Entwicklung, die sichere und effektive Praxis unterstützt und ausdrücklich nicht nur aus formalen Kursen besteht (HCPC – Health & Care Professions Council, 2026)
Entscheidend sind die HCPC-Standards: Registrants müssen u. a.
- Kontinuierlich CPD-Aktivitäten durchführen und dokumentieren,
- eine Mischung unterschiedlicher Lernaktivitäten nachweisen,
- reflektierend sicherstellen, dass die CPD zur Handlungskompetenz beiträgt,
- reflektierend sicherstellen, dass die CPD die Patient:innenversorgung verbessert und
- bei Zufallsauswahl an einem Audit teilnehmen (HCPC – Health & Care Professions Council, 2017).
Zu jeder Registrierungserneuerung (alle zwei Jahre) werden zufällig 2,5 % aller Paramedics ausgewählt und zur Einreichung eines CPD-Profils aufgefordert (HCPC – Health & Care Professions Council, 2026). Zusätzlich stellt der HCPC Sample-Profile bereit, die zeigen, wie CPD-Nachweise und Reflexion in unterschiedlichen Settings aussehen können (HCPC – Health & Care Professions Council, 2026c)
Warum ist das als Positivbeispiel relevant – ohne dass man es „übertragen“ muss? Weil es strukturell mehrere Schwächen des deutschen Stundenfokus adressiert:
- Weg vom reinen Anwesenheitsnachweis hin zu Dokumentation + Reflexion + Nutzenbezug.
- Anerkennung unterschiedlicher Lernformen, inkl. informaler und arbeitsplatznaher Aktivitäten.
- Stichprobenartige Überprüfung, die auch die Reflexion mit einbezieht
Das Beispiel zeigt, dass es möglich ist, CPD so zu rahmen, dass „Lernen“ und „Wirksamkeit“ näher aneinander rücken als „Stunden“ und „Teilnahme“.
Gute Fortbildungssysteme fokussieren auf Kompetenz, nicht auf Stunden
Wenn man die Befundlage zusammennimmt, entsteht ein relativ konsistentes Bild davon, was Fortbildung wirksamer macht, unabhängig vom Land:
- Bedarf statt Gießkanne: Lernaktivitäten sind wirksamer, wenn sie an reale individuelle Lücken anschließen
- Üben + Feedback + Wiederholung: Besonders bei Skills sind deliberate practice-Prinzipien zentral
- Transferbedingungen: Ohne Gelegenheit zur Anwendung, Feedbackkultur und Unterstützung bleibt Effekt klein
- Externe Spiegel statt nur Selbstbild: Selbstassessment ist begrenzt zuverlässig; Systeme brauchen Formen von Feedback/Assessment, die blinde Flecken sichtbar machen.
- Anerkennung informalen Lernens: Arbeitsplatznahes und informelles Lernen ist zentral und sollte nicht systematisch entwertet werden.
Diese Punkte sind keine Ideologie, sondern die logische Konsequenz aus der verfügbaren Evidenz. Wenn Fortbildung eine Verhaltens- und Versorgungswirkung entfalten soll, muss das System Lernmechanismen belohnen, nicht Anwesenheitsstunden.
Wenn wir Fortbildung im Rettungsdienst ernsthaft als Teil von Versorgungsqualität verstehen wollen, dann sollten wir aufhören, so zu tun, als wäre „30 Stunden“ eine pädagogische Leistung. Es ist eine Verwaltungsleistung. Kompetenz und gute Versorgungspraxis entstehen woanders.
Quellen
Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Huang, J. L. (2010). Transfer of Training: A Meta-Analytic Review. Journal of Management, 36(4), 1065–1105. https://doi.org/10.1177/0149206309352880
Davis, D. A., Mazmanian, P. E., Fordis, M., Van Harrison, R., Thorpe, K. E., & Perrier, L. (2006). Accuracy of Physician Self-assessment Compared With Observed Measures of Competence. JAMA, 296(9), 1094. https://doi.org/10.1001/jama.296.9.1094
Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education, 26(2), 247–273. https://doi.org/10.1080/158037042000225245
Forsetlund, L., O’Brien, M. A., Forsén, L., Mwai, L., Reinar, L. M., Okwen, M. P., Horsley, T., & Rose, C. J. (2021). Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and healthcare outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021(9). https://doi.org/10.1002/14651858.CD003030.pub3
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) (1992).
Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) (2024). https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/gesetze-und-verordnungen/gesetzblatt/detail/2024-66
Grossman, R., & Salas, E. (2011). The transfer of training: what really matters. International Journal of Training and Development, 15(2), 103–120. https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2011.00373.x
HCPC – Health & Care Professions Council. (2017, June 22). Standards of continuing professional development. https://www.hcpc-uk.org/standards/standards-of-continuing-professional-development/
HCPC – Health & Care Professions Council. (2026a, January 16). The CPD audit process. https://www.hcpc-uk.org/cpd/cpd-audits/
HCPC – Health & Care Professions Council. (2026b, January 18). Continuing professional development (CPD). https://www.hcpc-uk.org/cpd
HCPC – Health & Care Professions Council. (2026c, January 18). Sample CPD profile. https://www.hcpc-uk.org/cpd/completing-a-cpd-profile-for-audit/cpd-sample-profiles/
Land Schleswig-Holstein. (2017). Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG).
Verordnung zur Durchführung des hessischen Rettungsdienstgesetzes (RettDGV) (2011).
World Health Organization. (2020). Health worker safety: a priority for patient safety. https://www.who.int/docs/default-source/world-patient-safety-day/health-worker-safety-charter-wpsd-17-september-2020-3-1.pdf